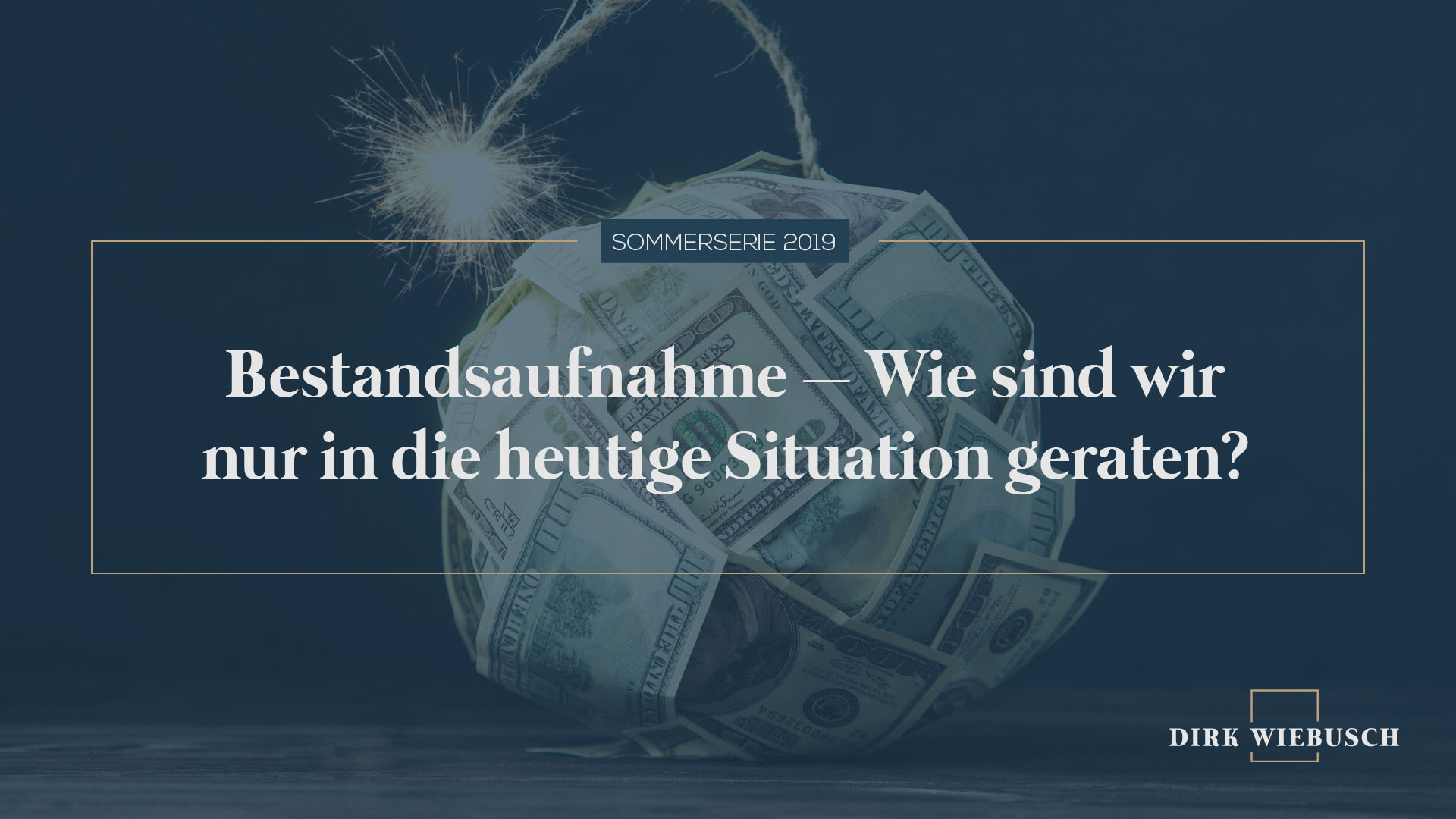In den meisten Bundesländern sind die Sommerferien bereits eingeläutet oder stehen kurz bevor. Für viele bedeutet das: endlich Gelegenheit für eine Auszeit mit der Familie. Damit Ihnen die langen Abende aber nicht allzu langweilig werden, möchte ich mit Ihnen über die kommenden Wochen kurz Revue passieren lassen: Wie ist die aktuelle Situation in der Branche der Finanzdienstleister, woraus hat sich diese entwickelt und wie wird die Zukunft aussehen?
Keine Sorge: Das hier ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern Urlaubslektüre mit Mehrwert für Interessierte. Deshalb ist unser gemeinsamer Blick in die Vergangenheit auch absichtlich vereinfacht dargestellt: Wichtig ist lediglich, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, wie wir am aktuellen Status quo angekommen sind und wie sich diese Entwicklung auch aus Sicht eines Unternehmers darstellt.
Vor 12 Jahren – Krisenstimmung
2007 – wer erinnert sich nicht? Facebook (damals noch vor allem unter Studenten beliebt) feierte gerade dreijährigen Geburtstag und Apple begann den bis heute anhaltenden Siegeszug des iPhones mit dem allerersten Modell. Doch es war auch der Zeitpunkt, als das internationale Bankensystem zu wanken begann.
Die Krise, die damals von den berüchtigten „Subprime Mortgages“ in den USA angestoßen wurde, erreichte insbesondere regional aufgestellte Institutsgruppen in Deutschland langsamer oder mit weniger Wucht: Diese Institute hatten die Krise kommen gesehen oder profitierten einfach davon, dass sich ihre Auswirkungen nur langsam auf dem regionalen Markt bemerkbar machten. Die Notenbanken reagierten damals, indem sie den Markt mit Geld fluteten, um des Problems Herr zu werden. Dadurch verlor Bargeld jedoch immer weiter an Wert – die Anlagenmärkte wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Die Reaktion auf Bankenseite
Auch in Deutschland waren es die Treasury-Abteilungen der Banken, Sparkassen und Volksbanken, die als erste auf die Entwicklung reagierten: Der Treasurer ging also zu seinem Vorgesetzten und sagte: Wir haben Probleme mit ersten Wiederanlagen. Die Vorgesetzten beschlossen daraufhin, einerseits laufende Kosten zu senken und andererseits kurzfristige Anlagen mit Flexibilität zu nutzen. Sie waren sich sicher: So könnte die Bank wieder problemlos mitspielen, sobald die Zinsen wieder steigen würden.
Viele Banken gingen damals fest davon aus, dass sich die Zinsen bald wieder erholen würden – doch diese blieben konstant niedrig. Die Depot-A-Manager erwirtschafteten deshalb weniger Ertrag als bislang und es wurde beschlossen, den Negativeffekt der geringeren Wiederanlagen auf andere Weise auszugleichen: Von nun an wurden massiv Kosten eingespart. Insbesondere Sachkosten, aber auch Budgets für Marketing, Weiterbildungen und ähnliche Ausgaben wurden stärker und stärker gekürzt – immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass der niedrige Zins nicht mehr viel länger anhalten würde.
Auch hier hat man sich vertan: Das Zinsniveau blieb nicht nur niedrig, es wurde durch weitere massive Zinssenkungen der Notenbanken auf fast „0“ reduziert und auch die nächsten Wiederanlagen litten unter demselben Problem. Schließlich begriffen die ersten großen Banken: Es musste von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen werden. Die Vorstände senkten interne Kosten, wo sie nur konnten: Projekte wurden eingefroren, die Zusammenarbeit mit vielen externen Beratern beendet. Auch am Personal wurde gespart: Gab es Kündigungen oder gingen Mitarbeiter in Rente, wurden ihre Posten häufig gar nicht neu besetzt – die verbleibenden Kollegen mussten den gleichbleibenden Arbeitsaufwand stemmen.
Der Worst Case vom Worst Case
Dieser extreme Sparkurs zeigte etwas Wirkung, doch diese war zu gering und kurzlebig. Und irgendwann waren alle schnellen, leicht umsetzbaren und kurzfristigen Sparoptionen ausgereizt. Die Vorstände versuchten nun, die Vertriebsmaschinerie zu verstärken. Dazu wurden Vertriebstrainings anberaumt und die Mitarbeiter wurden dazu ermuntert, noch näher am Kunden zu arbeiten, um zusätzliche Abschlüsse zu erzielen. Auch der Erfolg dieser Maßnahmen konnte nicht ewig währen.
Irgendwann stellten die Depot-A-Manager fest, dass bald alle Wiederanlagen wegbrechen würden – das wäre der Super-GAU gewesen. Die Gegenmaßnahmen wurden daraufhin immer extremer: Wo immer Geld zu machen war, musste in die Bresche gesprungen werden, um Kunden zu reaktivieren. Doch im Personalbereich kamen jetzt bereits auf eine bisherige 10-Personen-Abteilung lediglich noch 6 Personen, die ihre Prozesse immer weiter optimieren mussten.
Umschwenken
Im Rahmen dieser Prozessoptimierung wurde festgestellt: Weiteres Geschäft lässt sich in der aktuellen Situation nur noch im Firmenkundenbereich machen. „Cross-Selling“ war auf einmal das Zauberwort, der Verkauf weiterer Produkte und Dienstleistungen an bestehende Kunden. Aus heutiger Sicht ist es mehr als ironisch, dass dabei in vielen Banken die Optionen des Private Bankings und Vermögensmanagements kaum Beachtung gefunden haben.
Das Firmenkundengeschäft in Deutschland war damals noch klar aufgeteilt, jede Bank kannte ihren Platz auf dem Markt. Bis der Vorstandsvorsitzende eines großen Instituts einen Plan schmiedete: Die Angebote seiner Firmenkundenberatung sollten niedriger angesetzt werden, um damit in das System anderer Bankengruppen einzudringen. So sollten Kunden abgeworben werden. In der Finanzwelt war das Vorgehen dieses Instituts durchaus umstritten: Zu Beginn dieses Markteintritts weigerten sich die in diesem Segment etablierten Institute bei diesen – den Kunden real vorliegenden – Angeboten mitzugehen. Für viele Vorstände waren die Konditionen einfach nicht zu akzeptieren. Und so mussten viele Banken in dieser Zeit Kunden einfach gehen lassen, damit sie ihre Preise stabil halten konnten, während der „neue“ Marktspieler Dumpingpreise etablieren und sich diese auch leisten konnte.
Der Markt wird zum Käufermarkt
Für die Unternehmer war dies der Anbruch einer goldenen Zeit, denn bald mussten auch die anderen Institute dem neuen Preismodell folgen – während die Zinsen auf sehr niedrigem Stand stehen blieben.
Für die Institute und deren Mitarbeiter waren dies jedoch keine erfreulichen Zeiten, denn die Margen wurden immer kleiner, was das niedrige Zinsniveau zu einem immer ernsteren Problem werden ließ. An den Personalkosten wurde währenddessen weiter eingespart und gleichzeitig der Vertriebsdruck erhöht. Und Abschlüsse konnten praktisch nur noch zu Niedrigstpreisen erzielt werden.
Keine Neuigkeiten auf der Private-Banking-Ebene
Im Private Banking für Unternehmerkunden mit seinen vereinzelten, dafür aber vermögenden Kunden, änderte sich in diesem Zeitraum vergleichsweise wenig. Die meisten Banken beschäftigten sich noch nicht gezielt mit diesem Institutszweig. Doch einige Institute erkannten, dass das marktweite Potenzial des schnellen Cross-Sellings aufgrund der plötzlichen aggressiven Vertriebsmethoden von allen Seiten immer weiter abnahm. Die Erkenntnis, dass das private Vermögen der Unternehmer bislang kaum ausreichend gemanagt wurde, ist gewissermaßen die Geburtsstunde des professionellen Private Bankings von heute.
Zum damaligen Zeitpunkt wurden Unternehmer meist noch von privaten Bankiers und freien Vermögensberatern betreut. Banken, Sparkassen und Volksbanken bauten also in der Folgezeit verstärkt zusätzliche Private-Banking-Kapazitäten auf, um Erträge auch in diesem Bereich erwirtschaften zu können. Eine Bank gründete sogar eine eigene Einheit zur ganzheitlichen Beratung von Unternehmern – Firmenkundenberatung und Private Banking in einem Geschäftsfeld, um besonders großvolumige Geschäfte abgreifen zu können. Es wundert kaum, dass durch diesen „Gold Rush“ erneut die Preise auf Dumpingniveau fielen und die Margen immer geringer ausfielen. Dieses Mal dann eben auch im Private Banking – einem Segment, in welchem bis dahin die Preise noch recht stabil waren.
Der Ist-Zustand
All dieser Konkurrenzdruck hat die aktuelle Finanzwelt fundamental verändert. Und die Gesetzgebung tat ihr Übriges. Risiken wurden neu bewertet und Produkte wurden, obwohl durch mehrere Finanzinstanzen geprüft und für rechtens befunden, rückwirkend verboten bzw. als steuerschädlich eingestuft.
Dies alles hat dazu geführt, dass sich Finanzprodukte und Dienstleistungen heute weitestgehend gleichen – zumindest aus Sicht der Unternehmer, die heute einen klassischen Käufermarkt sowie absolute Hoheit über Investitionen genießen. Gleichzeitig haben die meisten großen Institute, abgelenkt von der Krise, seit 2007 die Digitalisierung der Finanzwelt fast völlig verschlafen und müssen in diesem Bereich heute schnell nachbessern. Das kostet Geld, das aber aufgrund der sehr scharfen Regulierungsrichtlinien in das Eigenkapital gelegt werden muss. Dies bedeutet einen riesigen Projektdruck. Vor allem für kleinere Institute, bei denen in allen Projekten immer dieselben 5 bis 10 Personen involviert sind.
Neue Herausforderungen
Die Veränderungen auf dem Finanzmarkt über die letzten 12 Jahre lassen sich mit einem brennenden Haus vergleichen, auf das zum Löschen immer mehr Wasser (Geld der Notenbanken) gesprüht wurde. Das Feuer wurde dadurch gebändigt, doch beim anschließenden Trocknen wurde nicht alle Feuchtigkeit aus den Zwischenwänden entfernt. Und heute wundern wir uns, warum die neuen Bewohner des Hauses so häufig krank werden – ohne zu ahnen, dass sich mittlerweile Schimmel kreuz und quer durch die Zwischenwände zieht.
Und täglich zieht sich die Schlinge weiter zu. Unter anderem durch immer mehr neue gesetzliche Regelungen, wie BASEL III, MiFID, WIKR und einige mehr. Dadurch müssen „schlechte“ Unternehmen aussortiert werden, um die Eigenkapitalrichtlinien einzuhalten. Top-Unternehmer haben sich durch diese Situation jedoch noch besser aufstellen müssen – die Eigenkapitalquote der Firma musste gestärkt werden und der Cash-Flow wurde verbessert, wodurch sie plötzlich weniger Bankkredite benötigen.
Das heißt, die Regulierungsbehörden haben den Hebel zwar richtig angesetzt – Stärkung der Unternehmen – aber es kam, wie es kommen musste: Die Top-Unternehmen sind nun noch unabhängiger von Banken und die „schlechten” Unternehmen haben es nicht geschafft. Und durch die verschärften Risikovergabe-Prozesse hat man sich als Bank von diesen Kunden getrennt, das Risiko zurückgefahren oder neue von diesen „schlechteren” Kunden gar nicht erst aufgenommen. Das Kunden-Portfolio ist dadurch zwar deutlich qualitativer geworden, jedoch mit einem großen Problem: Man hat nun viele Kunden, die eigentlich keine Bank im klassischen Sinne mehr brauchen.
Gleichzeitig besteht auf der privaten Seite kaum Investitionsinteresse. Als einzige Ausnahme zählt hier das Immobiliengeschäft, auf das immer mehr Banken dementsprechend großen Wert legen. Das Risiko dieser Entwicklung, eines Tages durch ein wegfallendes Immobiliengeschäft plötzlich „nackt in der Brandung zu stehen”, nimmt dadurch weiter zu.
Die Innensicht der Unternehmer
All diese Veränderungen auf den nationalen und internationalen Finanzmärkten haben natürlich auch die Unternehmer erkannt. Insbesondere kann man davon ausgehen, dass Familienunternehmen und Unternehmerfamilien die Entwicklung des Fokus von der Beratung über den Vertrieb bis hin zum Verkaufen genau beobachtet haben.
Die meisten Unternehmer empfinden diese Entwicklung auch nicht direkt als negativ – sie verkaufen selbst eigene Produkte und wissen, dass sich mit Beratung allein kaum ein Unternehmen langfristig über Wasser halten kann. Allerdings stößt dieses Verständnis für die Situation der Banken an seine Grenzen, sobald der Verkaufsdruck als übertrieben empfunden wird. Deshalb ist es auch wenig hilfreich, bei Top-Unternehmern Zielmengen an qualifizierten Gesprächen vorzugeben. Das wird leicht als aufdringlich wahrgenommen und der Unternehmer bekommt das Gefühl, Zeit zu vergeuden, die er in sein Kerngeschäft investieren sollte.
Dementsprechend sollte ein gutes Maß an Betreuung gefunden werden: weder zu häufige Gespräche (gerade bei langjährigen Kunden mit mehreren Bankverbindungen), noch zu selten.
Wo wir gerade stehen
Und so gelangen wir schließlich zum Status quo, in dem Unternehmer davon ausgehen können, dass sie durch das angesammelte Eigenkapital kaum Bankkredite benötigen werden – und falls der Fall doch einmal eintritt, können sie sich auf Dumpingpreise freuen. Gleichzeitig scheuen die Unternehmer Investitionen außerhalb des Immobilienmarkts. Welche Implikationen diese Situation auf das aktuelle Bankengewerbe sowie die Identität und Arbeitsweise der Institute hat, erfahren Sie im folgenden Artikel der Sommerserie 2019.
Kontakt

Dirk Wiebusch
info@ifuf.de