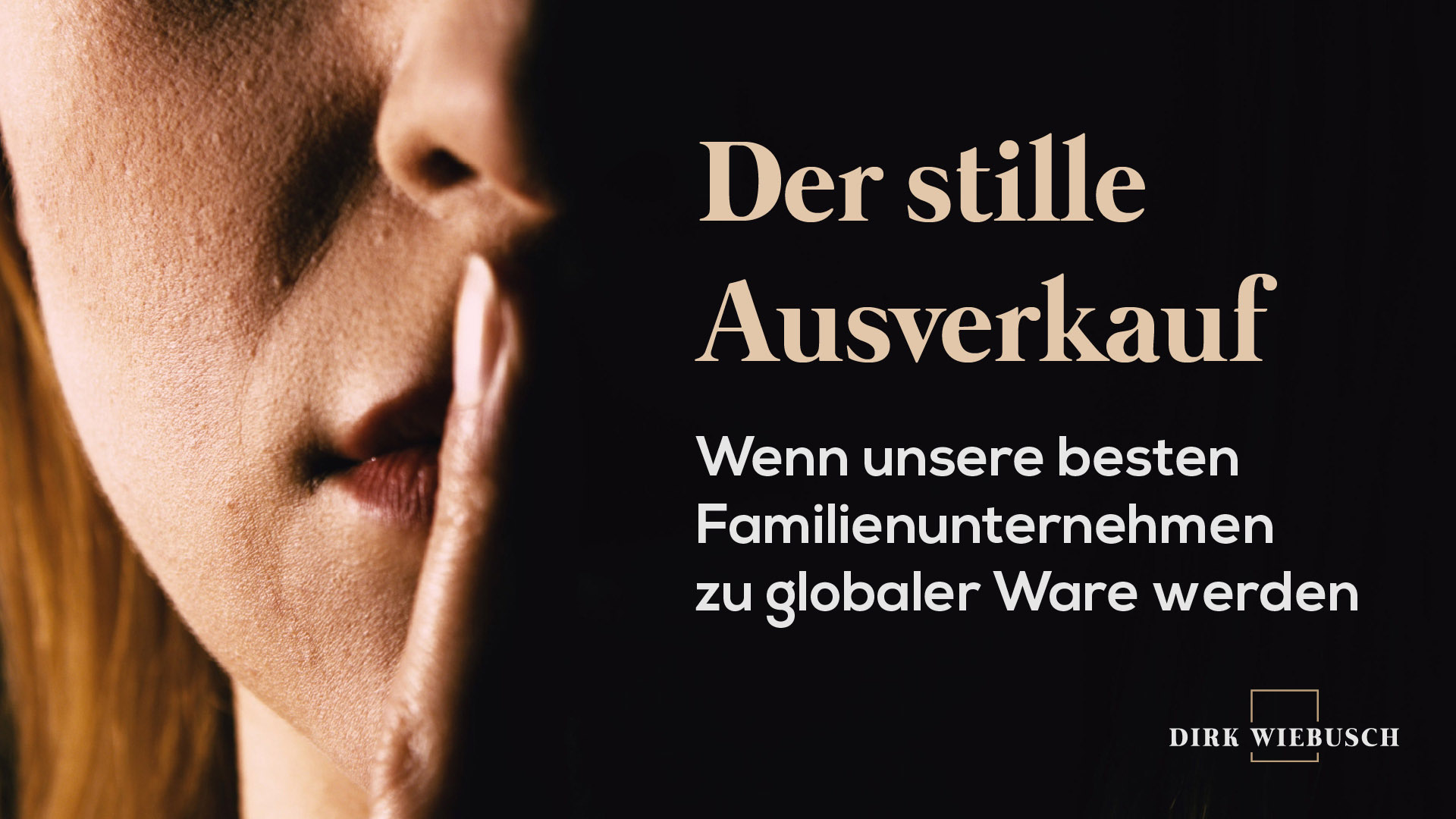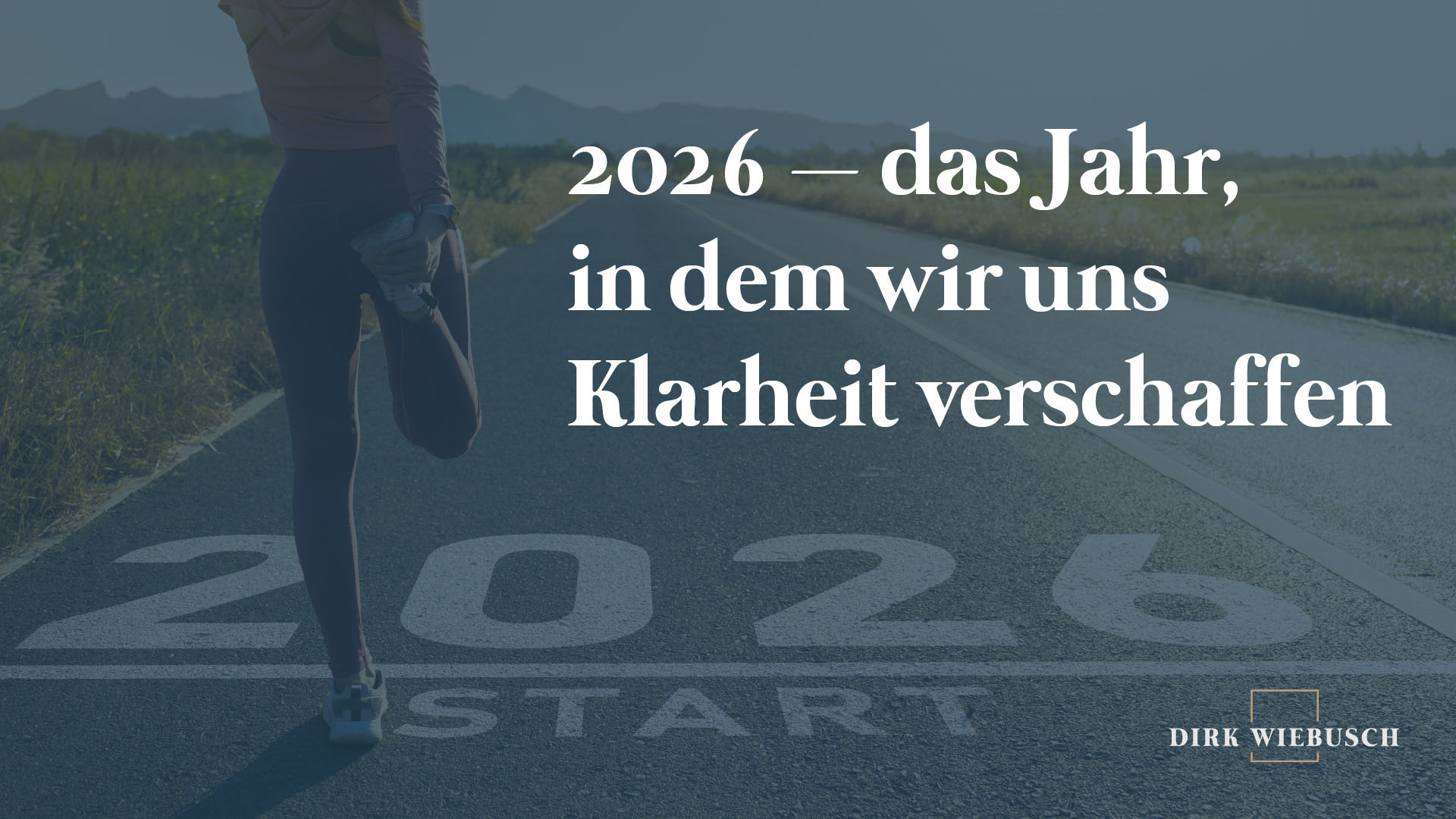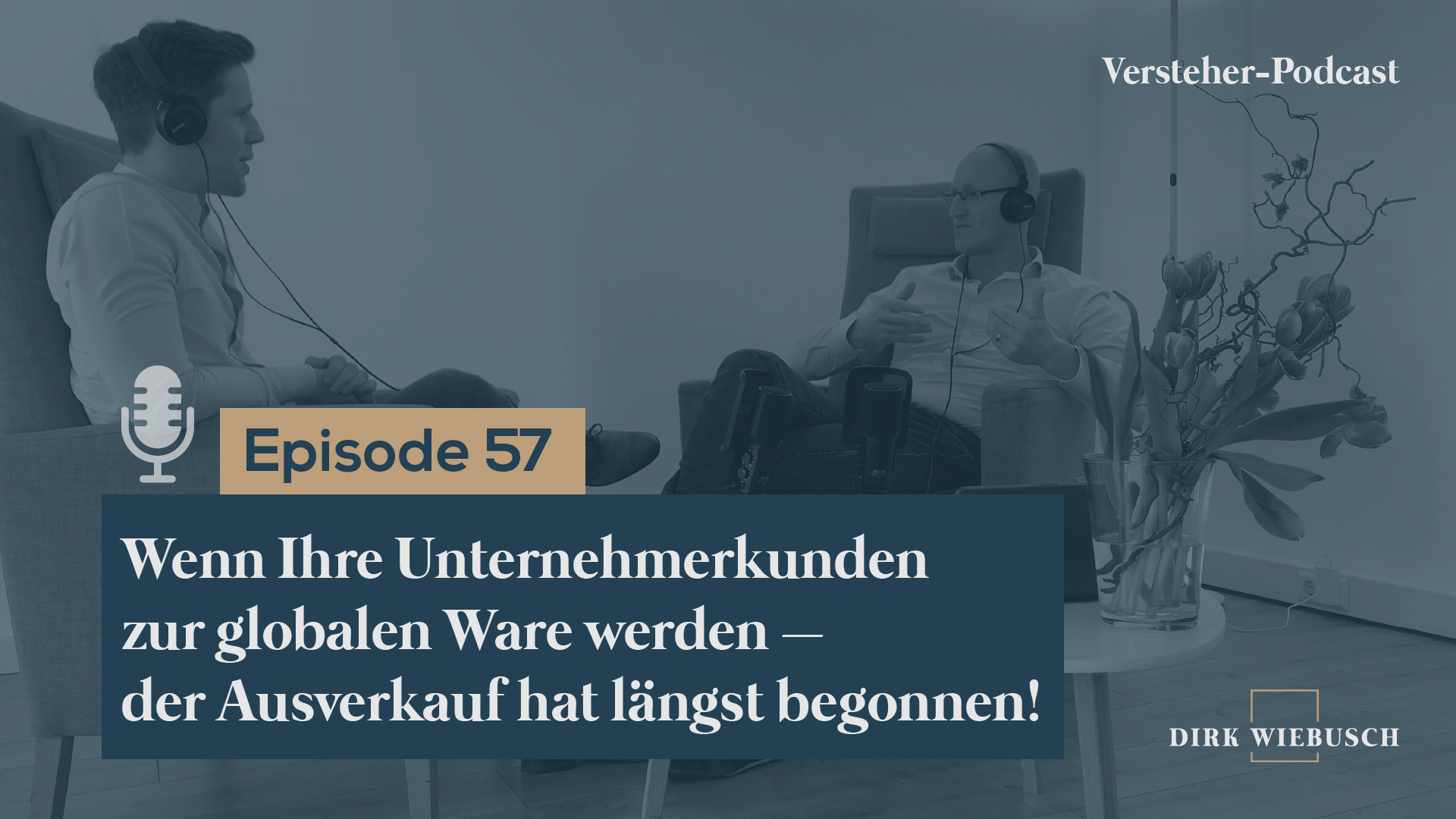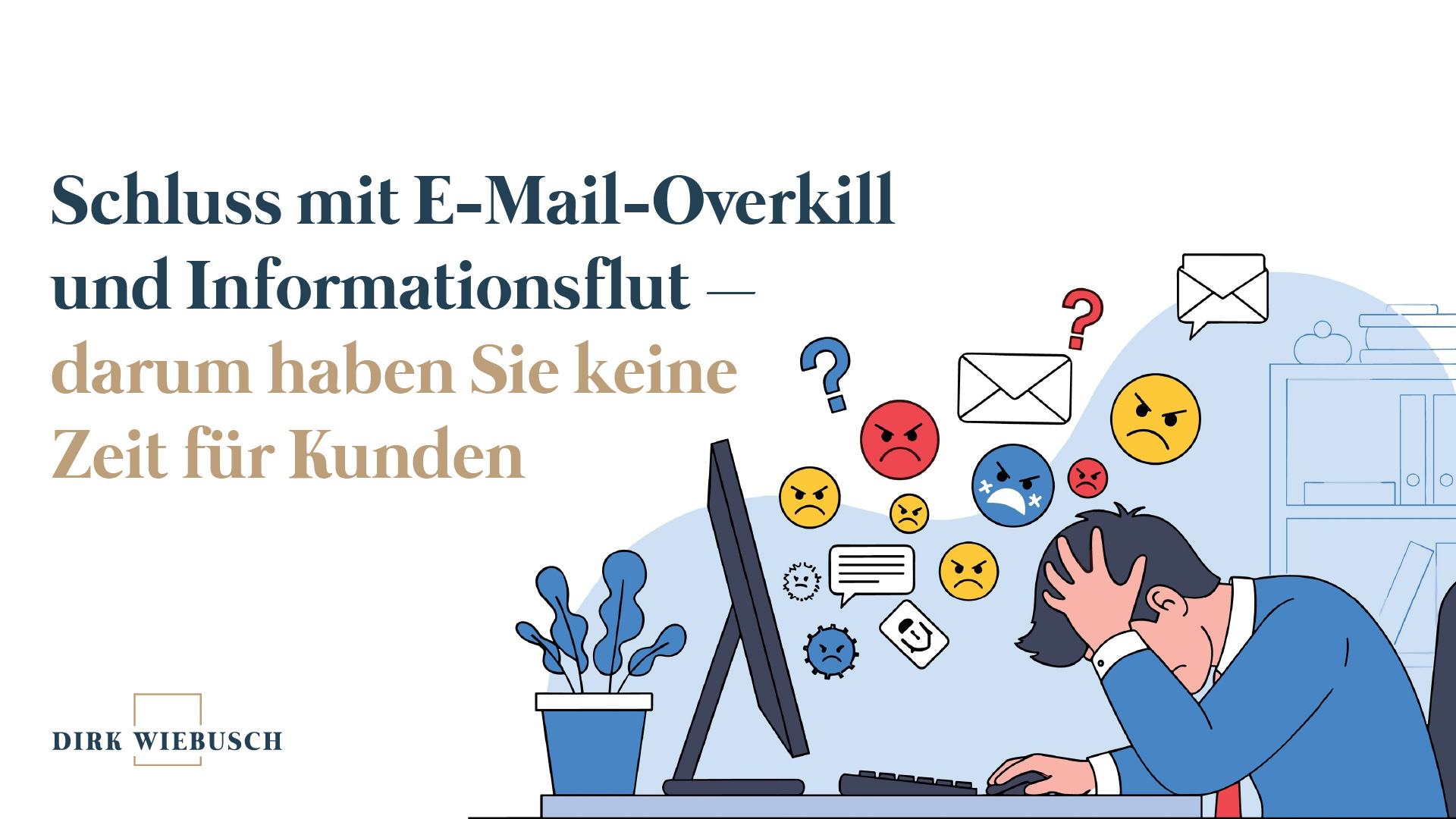Was für Banken, Volksbanken, Sparkassen und deren Firmenkunden- sowie Private-Banking-Berater jetzt wichtig ist
In vielen Regionen Deutschlands scheint auf den ersten Blick alles beim Alten: Das vertraute Firmenlogo prangt am Hallentor und die bekannten Ansprechpartner sind erreichbar. Doch hinter dieser Fassade hat sich unbemerkt Entscheidendes verändert. Denn immer häufiger verkaufen Inhaberfamilien ihre Unternehmen ohne öffentliche Aufmerksamkeit an internationale Investoren, Private-Equity-Fonds oder verschachtelte Beteiligungsgesellschaften. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich die Dynamik: Gut geführte Familienunternehmen werden durch ausländisches Kapital akquiriert, häufig als Teil komplexer Beteiligungskonstrukte und strategischer „Buy-and-Build“-Pläne.
Dieser Beitrag beleuchtet, was hinter diesem stillen Ausverkauf steckt, warum er gerade jetzt an Fahrt aufnimmt und was Entscheider in Banken, regionalen Netzwerken und den Familienunternehmen selbst jetzt wissen müssen, um die Risiken zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Wachsende Herausforderungen für Firmenkundenberater regionaler Finanzinstitute
Für Firmenkundenberater in regionalen Finanzinstituten ist diese Entwicklung teilweise schwer einzuordnen. Es fehlt oft eine Kombination aus Erfahrung, Zeit oder Transparenz, um die komplexen Strukturen hinter einer solchen Transaktion frühzeitig erkennen und bewerten zu können.
Genau hier liegt jedoch die Gefahr: Was kurzfristig wie ein guter Deal für alle Beteiligten aussieht, kann sich langfristig als schleichender Substanzverlust für die gesamte Region entpuppen. Die Folgen reichen vom Verlust von Arbeitsplätzen über den Abfluss von wertvollem Know-how bis hin zur schwindenden wirtschaftlichen Selbstbestimmung.
Die unsichtbare Dynamik – und warum sie jetzt an Fahrt gewinnt
Dieser „stille Ausverkauf“ ist kein zufälliges Phänomen, sondern das Resultat struktureller Entwicklungen ökonomischer, strategischer, kultureller und geopolitischer Natur. So trifft beispielsweise die zunehmend drängende Nachfolgefrage auf eine neue Generation von Käufern aus Nah- und Fernost sowie Nordamerika.
Folgende vier Hauptursachen lassen sich identifizieren:
- Zahlreiche Unternehmer stehen vor dem Übergang in den Ruhestand, ohne familiäre Nachfolger zu haben. Angesichts steigender bürokratischer Belastungen und eines zunehmenden Regulierungsdrucks erscheint der Verkauf des Unternehmens oft als einzig gangbarer Weg.
- Gleichzeitig fehlt es aus Investorensicht an brauchbaren Zielunternehmen mit ausreichend Tragweite (Umsätze zwischen 500 Millionen und 2 Milliarden Euro). Diese sind ohnehin rar, bereits veräußert oder stehen gar nicht zum Verkauf. Daher kumulieren Investoren zunehmend Firmen zu skalierbaren Einheiten, wodurch aus einer Vielzahl von Mittelständlern ein milliardenschwerer Verbund entstehen kann. Das „Buy-and-Build“-Modell avanciert zur dominierenden Private-Equity-Strategie, oft geschickt getarnt hinter komplexen Zwischenholdings.
- Internationale Investoren aus dem arabischen, asiatischen und nordamerikanischen Raum bringen beachtliche strukturelle Vorteile mit. Ergänzt wird dies durch steuerlich optimierte Unternehmensstrukturen und einen strategischen Zugang zu globalen Märkten.
- Während diese globalen Akteure entschlossen und strategisch handeln, mangelt es in vielen Regionen an adäquaten Gegenkräften, wie Co-Investorenmodellen, Beteiligungsplattformen oder überhaupt erst effektiven Frühwarnsystemen.
Die Konsequenz: Wer nur auf Bilanzen schaut, erkennt den Verkaufsdruck oft erst, wenn der Notartermin längst steht.
Die drei Phasen der Übernahme: zwischen Effizienzsteigerung und Identitätsverlust
Der Wandel vom Familienunternehmen zur reinen Finanz-Ware vollzieht sich typischerweise in drei Phasen:
- Erwerb: Nach außen bleibt vieles vertraut, während intern eine intensive Analyse von Prozessen, Personal und Verträgen einsetzt – i.d.R. gefolgt von sofortiger, mitunter ruppiger Anpassung.
- Optimierung: Weitere Unternehmen werden gezielt hinzugekauft sowie zentralisiert und die Führungsebenen gebündelt, ausgetauscht oder freigesetzt.
- Exit: Weiterverkauf bei angestrebter Zielgröße, oft zulasten von Unternehmenskultur und regionaler Verankerung.
Die Region wird in diesem Szenario häufig auf die Rolle eines bloßen Produktionsstandortes reduziert, ohne eine eigene Stimme zugestanden zu bekommen. Sie ist der übergeordneten Finanzstruktur unterworfen.
Um die Konsequenzen vollumfänglich zu erkennen, muss der Blick aber noch weiter schweifen. Denn für Sie als Firmenkundenberater hat das ebenfalls weitreichende Folgen. Lassen Sie uns also erneut einen Blick hinter die Fassade für Unternehmen, Regionen und Bankpartner wagen.
Der Wolf im Schafspelz: gute Deals und schwerwiegende Sekundäreffekte
Ein Eigentümerwechsel bedeutet einen tiefgreifenden Wandlungsprozess, der zunächst die organisationalen Strukturen und darauffolgend die betroffenen Menschen erfasst. Formal mag der Unternehmensname fortbestehen, doch Zentralisierung hält Einzug in vielen Unternehmensbereichen:
- Buchhaltung
- Personalmanagement
- IT
- Entscheidungen in Konzernzentrale
- Einkauf international gebündelt
Für viele regional verwurzelte Mitarbeiter bedeutet dies eine Entwertung ihrer Rollen oder gar deren vollständigen Wegfall. Eine besonders prägnante Praxis ist das sogenannte „Expert-Cherry-Picking“: Spezialisten werden mit Boni gehalten, während als „austauschbar“ eingestufte Kräfte in Verwaltung, Assistenz oder Disposition unter erheblichen Druck geraten.
Letztlich ersetzen Automatisierungsprozesse die Arbeitskraft und Standardisierung tritt an die Stelle individueller Abläufe. Das Resultat ist oft eine Belegschaft ohne Bindung und ein Unternehmen, dem seine ursprüngliche Identität abhandengekommen ist.
Regionale Sekundäreffekte
Die Wertschöpfung verlagert sich: Gewinne, die früher in der Region verblieben, fließen nun ab. Investitionsentscheidungen werden primär nach Kriterien wie Kosteneffizienz und steuerlicher Attraktivität getroffen, was zu einer Abwanderung von Investitionen führen und die regionale Substanz aushöhlen kann. Langjährige Beziehungen zu lokalen Dienstleistern werden durch zentrale Einkaufsabteilungen aufgelöst, Verträge neu verhandelt, Margen gedrückt oder Zulieferer gänzlich ersetzt. Ein ganzer Mittelstand verliert seine Aufträge – still und ohne Schlagzeile.
Hinzu kommen Brain-Drain und Entwurzelung. Qualifizierte Fachkräfte in Bereichen wie Controlling, IT oder Technik spüren die Veränderungen unmittelbar. Viele suchen sich neue Möglichkeiten, andere werden versetzt, wodurch wertvolles Know-how irreversibel verloren geht. Die daraus resultierende Verunsicherung kann zu einer Zurückhaltung bei Konsumentscheidungen und Investitionen führen. Das regionale Konsumklima (z.B. Restaurantbesuche gehen zurück) und der Immobilienmarkt können erstarren, die Region gerät ins Stocken, die Frustration steigt, Gestaltungsspielräume schwinden.
Zwischenruf: Die Politik als Sündenbock – oder bequemer Fluchtpunkt?
Die Schuld wird dann häufig in der Politik gesucht. Oft hört man Sätze wie: „Kein Wunder – bei der Bürokratie in Deutschland kann man ja gar nicht mehr Unternehmer sein!“
Die Wahrheit ist: Deutschland ist regulatorisch überkomplex, steuerlich überfordert, digital unterentwickelt. Aber wenn es wirklich so schlimm wäre, warum kaufen dann internationale Investoren genau hier? Häufig sind die zwar zweifellos vorhandenen politischen Versäumnisse eine willkommene Entschuldigung für strategische Trägheit und die reine Verwaltung des Geschäfts, statt es zu führen. Die Politik ist nicht der Grund. Sie ist der Hintergrund. Wer Verantwortung abgibt, verliert Gestaltungskraft.
Sparkassen, Genossenschaftsbanken und regionale Großbankenkontakte werden ersetzt
Während ein Unternehmensverkauf kurzfristig Liquidität freisetzt und das Private Banking belebt, wird der langfristige Verlust an Kundenbeziehung, Relevanz und Einfluss übersehen.
Private-Equity-Gesellschaften bringen ihre eigenen Finanzierungspartner mit sich.
Kreditlinien werden umgeschuldet, bestehende Bankverbindungen gekappt, und strategische Gespräche verlagern sich an internationale Finanzzentren wie London, Zürich oder Dubai. Was bleibt, ist eine leere Kundenakte und eine spürbare Lücke im regionalen Banking.
Der Verkaufserlös führt zwar auch zu Vermögensbewegungen im Private Banking, doch wenn der Firmenkundenberater den Private Banker noch nicht vorgestellt hat, dann besteht dahingehend keine feste Bindung an die bisherige Firmen-Hausbank. Stattdessen schaut der Unternehmer sich nach dem Deal anderweitig um. Hier stehen diverse Anbieter bereit – von Family Offices bis zu NextGen-Beratern mit Digitalversprechen. Wer nicht proaktiv agiert, riskiert, den Kunden und sein Kapital komplett zu verlieren, im schlimmsten Fall für immer. Denn sowohl für den Unternehmer als auch die Private-Banking-Einheit ist es ein sogenanntes „once in a lifetime“-Ereignis.
Warum die Entwicklungen so lange unentdeckt oder unterschätzt bleiben
Bankintern zeigen sich fehlende Routinen und blinde Flecken. In vielen Instituten mangelt es an ausreichender Erfahrung in Bezug auf die Komplexität solcher Transaktionen. Verschachtelte Käuferstrukturen, verdeckte Kapitalanfragen oder Rückzugstendenzen bleiben oftmals unerkannt, bis der Deal schon kurz vor dem Abschluss steht. So werden oft entscheidende Indikatoren übersehen:
- Know-how-Transfers Monate vor dem Deal
- intensive Reiseaktivitäten der Geschäftsführung
- plötzliche Strategiewechsel oder systematische M&A‑Aktivitäten im Hintergrund
Die Beteiligten können häufig auch gar nicht angemessen reagieren, da entscheidende Faktoren bei den wichtigsten Akteuren fehlen:
- Unternehmer: brillante Macher und Profis in ihrem Feld ohne ausreichend Verständnis für die verschachtelten Investorstrukturen
- Steuerberater: loyal und vertraut mit dem internen Zahlenwerk, aber ohne Deal-Radar
- Bankberater: vor Ort, aber außen vor, weil zu spät informiert und nur reaktiv tätig
Das System sieht für Sie als Berater in den Vorgängen keine Rolle vor. Also muss diese proaktiv geschaffen werden.
Es bedarf daher mehr Kompetenz, mutiger Fragen und eines Blicks hinter die reine Bilanz. Notwendig ist ein Frühwarnsystem innerhalb der Kundenstruktur, eine geschärfte Transaktionskompetenz im Firmen- und Private Banking und vor allem ein tiefes Verständnis der Käuferlogik. Denn nur wer versteht, wer kauft und warum, kann im richtigen Moment die entscheidenden Fragen stellen.
Proaktiv handeln: Ihre Rolle als strategischer Partner im Wandel
Es geht bei dieser Betrachtung nicht darum, Schuldige zu benennen, sondern eine übergeordnete Dynamik zu verstehen. Niemand trägt „Schuld“. Doch alle sind betroffen. Und wer nicht vorbereitet ist, wird zum Spielball einer Entwicklung, die längst im Gange ist. Der stille Ausverkauf ist kein jäher Tsunami, sondern eine schleichende Erosion mit nachhaltiger Wirkung.
Drei zentrale Erkenntnisse sollten die Handlungen aller Beteiligten leiten:
- Wenn gerade gesunde und innovative Unternehmen veräußert werden, ist dies kein Zufall, sondern das Resultat eines strategischen „Cherry-Pickings“ durch Investoren mit klarem Plan. Zweitens, der Ausverkauf ist keine bloße Theorie – er ist gelebte Realität.
- Wer genau hinsieht, erkennt eine Zunahme an Firmen mit neuen Eigentümern, immer weniger lokale Entscheidungsträger und immer dieselben Investoren, die mit denselben Mustern agieren.
- Wer nicht handelt, wird zum Getriebenen.
Empfehlungen für Berater, Banken und Entscheider
In dieser sich verändernden Landschaft ist eine Neudefinition der Beraterrolle unumgänglich. Für Sie als Firmenkundenberater bedeutet dies, sich vom reinen Finanzierer zu einem strategisch agierenden Gesprächspartner zu entwickeln. Es ist unerlässlich, ein Radar für Frühindikatoren zu kultivieren und proaktiv Gespräche über Buy-and-Build-Modelle, Investorentypen und Exit-Logiken zu führen, noch bevor ein potenzieller Käufer in Erscheinung tritt.
Viele Unternehmer verfügen über niemanden, der diese kritischen Themen frühzeitig und objektiv anspricht. Bauen Sie Transaktionskompetenz auf, auch wenn Sie nicht zum M&A‑Profi avancieren.
Für Sie als Private Banker eröffnet der Verkaufserlös die Chance, strategisches Vermögen zu gestalten. Begleiten Sie Familien nicht nur bei der reinen Geldanlage, sondern unterstützen Sie sie beim umfassenden Neuaufbau ihres gesamten Vermögenshaushalts.
Positionieren Sie sich nicht als bloßer Produktvermittler, sondern als Sparringspartner auf Augenhöhe. Ergänzend dazu sind für Vorstände und Regionalentscheider Maßnahmen wie die Entwicklung von Frühwarnsystemen für strategisch gefährdete Unternehmen sowie die Prüfung von Co Investitionsmodellen oder regionalen Beteiligungsplattformen von entscheidender Bedeutung. Es gilt, das Transaktionswissen aktiv im Haus zu fördern.
Verantwortung neu verstehen
Der stille Ausverkauf ist kein unaufhaltsames Naturgesetz, sondern vielmehr das Ergebnis unterlassener Kommunikation, mangelnder Transparenz und unzureichender Vorbereitung. Wenn wir unsere Unternehmen, Regionen und Vermögenswerte nachhaltig sichern möchten, müssen wir den Dialog früher und umfassender suchen.
Nicht lauter – aber tiefer.
Nicht schneller – aber mit mehr Weitblick.
Nicht defensiv – sondern mutig.
Und diese Erkenntnis gilt nicht nur für die Unternehmer selbst, sondern in gleichem Maße für Sie als strategischen Partner. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diesen Strukturwandel aktiv mitzugestalten und die Weichen für eine resilientere Zukunft zu stellen.
Kontakt

Dirk Wiebusch
info@ifuf.de