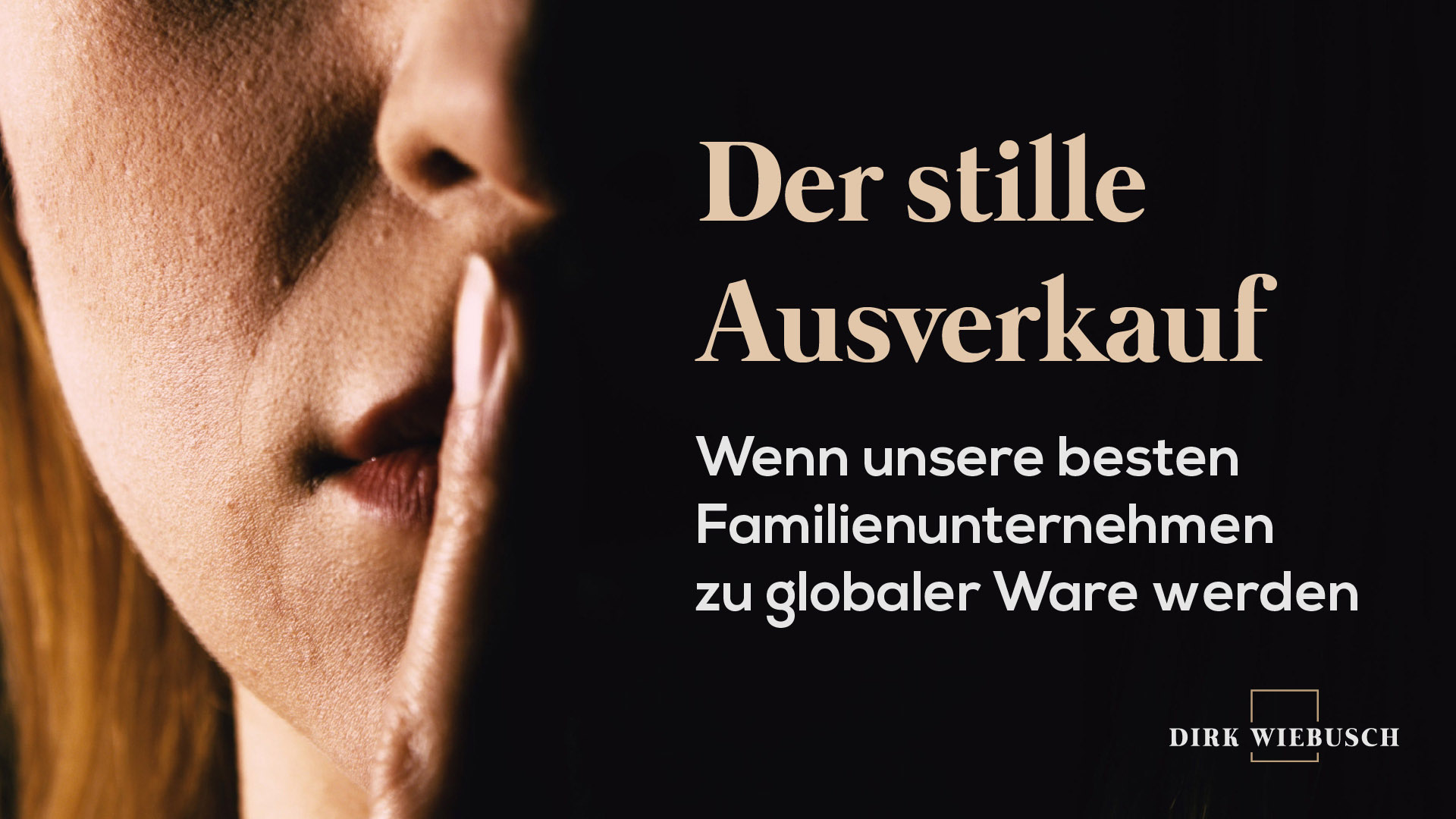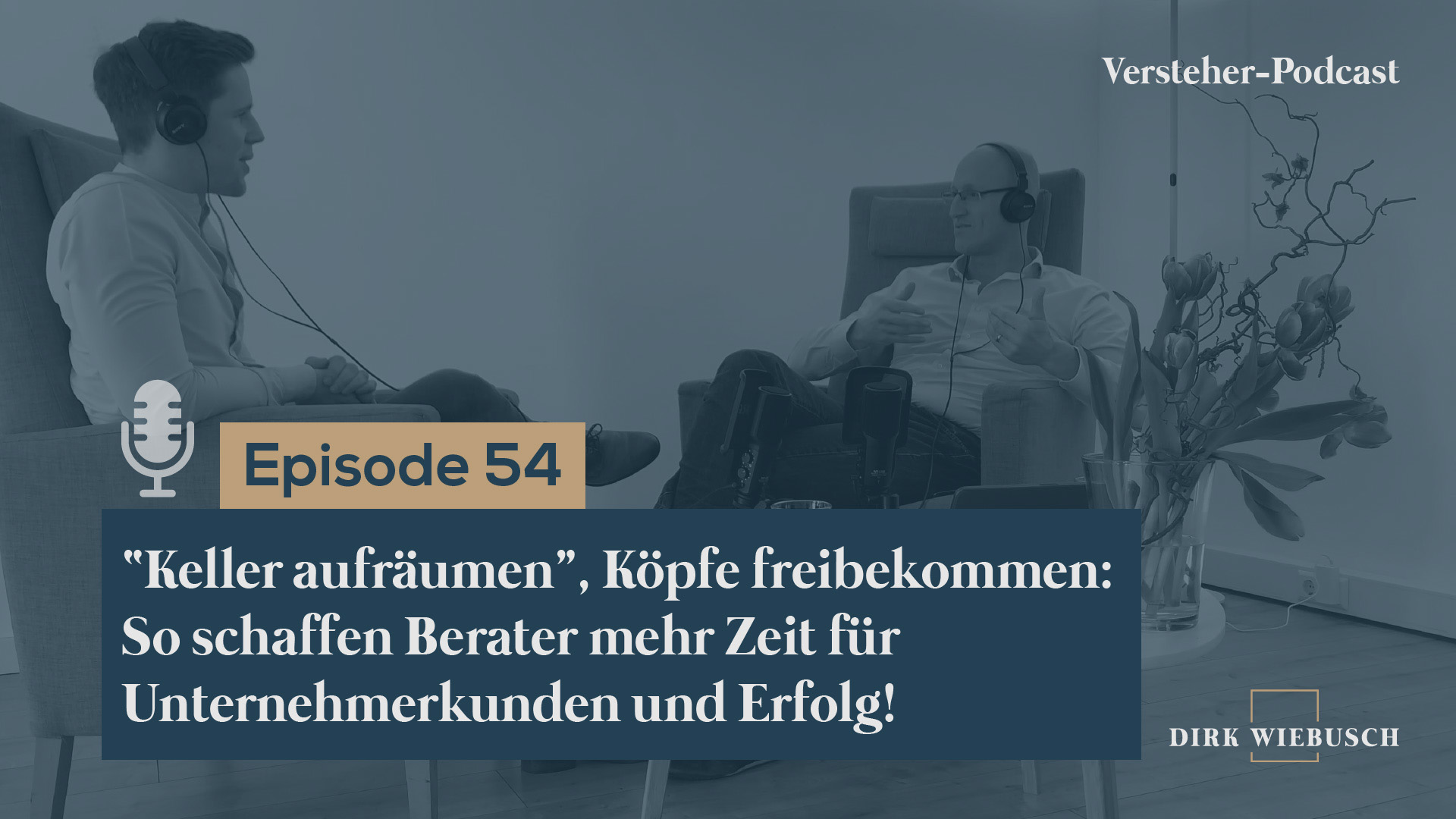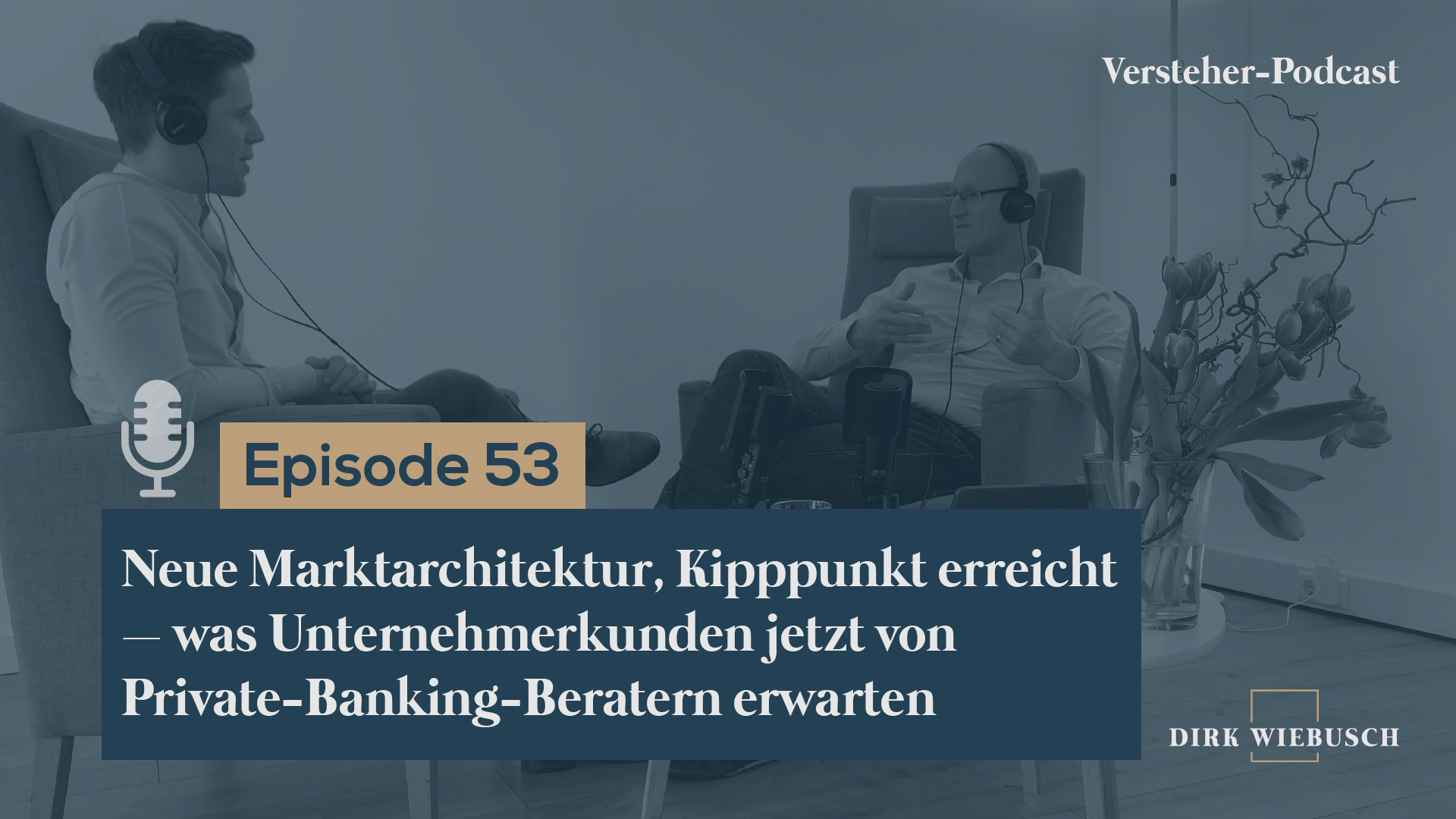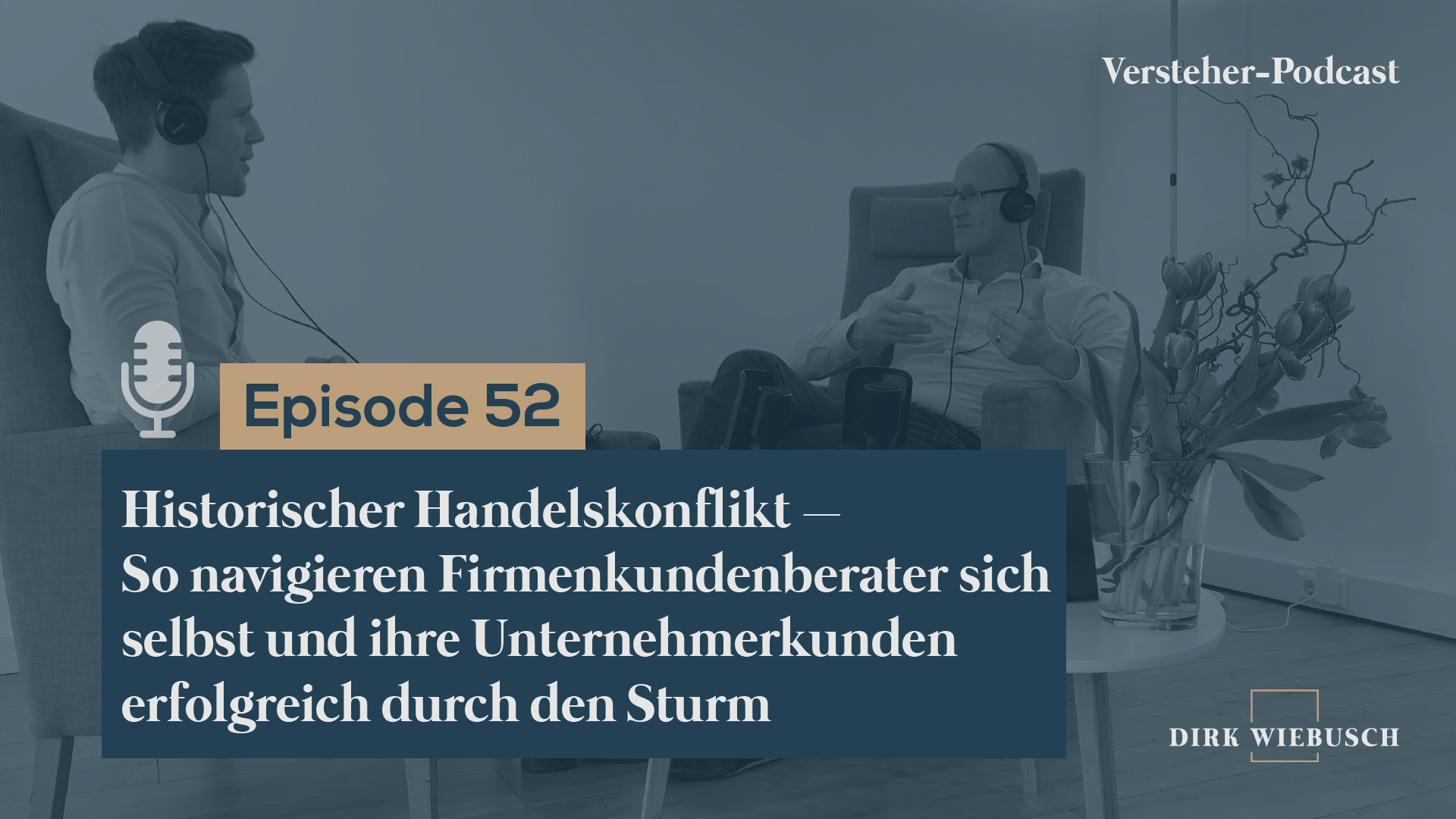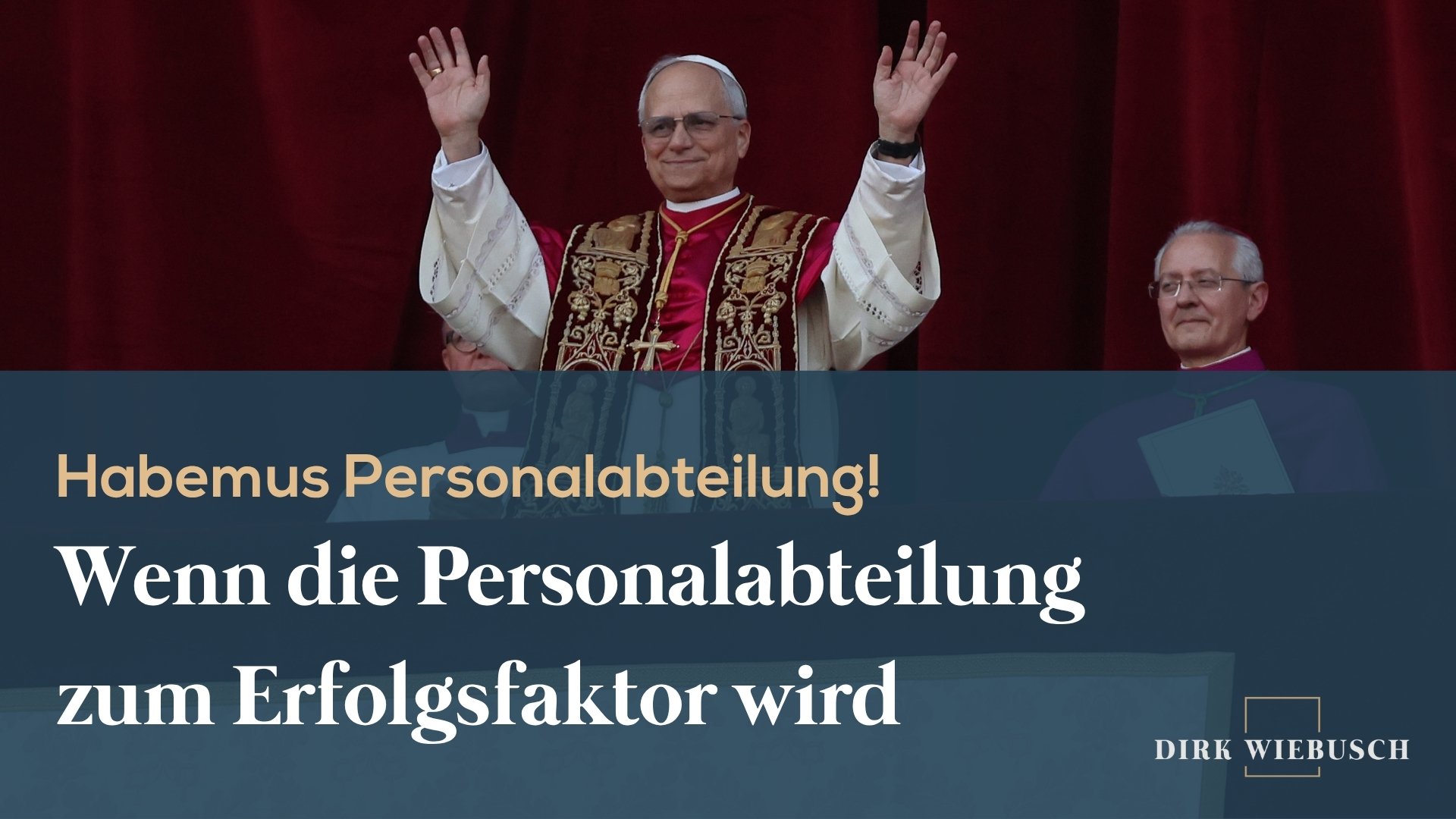Erinnern Sie sich noch daran, wie ich in den Corona-Jahren in einem Artikel hier im Versteher-Magazin den neu entdeckten Pragmatismus in den Banken gelobt habe? Ich empfand das damals als sehr positiv, dass Dinge einfach mal wieder gemacht wurden, statt selbst dort noch auf die Regularien zu pochen, wo diese nicht rechtlich notwendig beziehungsweise sicherheitstechnisch sinnvoll waren. Doch ich habe damals schon vorhergesagt, dass diese Entwicklung nur temporär sein würde. Und genau diese Situation haben wir heute.
Aktuell gibt es zum Beispiel in zahlreichen Regionalinstituten Projekte zur Neuausrichtung der Geschäftsstellenstruktur. Das heißt: Automatisierte Segmentierung, um schlummernde Potenziale aus den Geschäftsstellen ins Private Banking zu überführen. In diesem Artikel möchte ich Ihnen einen praxiserprobten Tipp an die Hand geben, wie Sie trotz oftmals technokratischer und statischer Vorgaben die Segmentierung als ein nützliches Werkzeug zur Erschließung neuer Erträge nutzen können.
Pauschale Segmentierung? Lieber mit Augenmaß!
Von meinen Artikeln, LinkedIn-Beiträgen und Podcasts her wissen Sie wahrscheinlich schon: Ich persönlich bin kein großer Freund von pauschaler Segmentierung. Das hat viele Gründe, doch sie alle basieren auf derselben Beobachtung: Pauschale (und eventuell automatisierte) Segmentierungen erzeugen oft eine Schein-Präzision, die deutlich weniger nützt als ein bisschen menschliches Hirnschmalz.
Ein Beispiel: Es gibt in vielen Filialen noch Geschäftsstellenleiter, die besonders attraktive Kunden aus der Region persönlich betreuen. Das sind dann oft Kunden, die explizit keine weiteren Beratungsleistungen wünschen oder benötigen. Was aber, wenn das Institut nun pauschale Kriterien aufstellt, nach denen zum Beispiel Kunden innerhalb eines gewissen Volumen-Rahmens automatisch ins Private Banking segmentiert werden? Dann sind diese wichtigen Kunden plötzlich (gegen ihren Willen) nur noch Teil der mitunter Hunderte Kunden, die vom Private-Banking-Berater betreut werden. Eine persönliche Betreuung kann dann kaum noch stattfinden und das Ergebnis ist tendenziell eine eher schlechtere Kundenbeziehung.
Was ich immer wieder sehe, ist, dass aufgrund des technischen (Automatisierung, KI etc.) und regulatorischen Drucks (vor allem auch durch den Echtzeit-Zugriff auf Kunden durch die Aufsichtsbehörden) eine gewisse Dringlichkeit bei der Segmentierung entsteht. Darum wird die Segmentierung oft automatisiert auf Basis eines starren Regelwerks durchgeführt. Und aus demselben Grund ist es dann hinterher oft nötig, die Kunden noch mal aufwendig „händisch“ nachzuprüfen. Da finden sich dann zum Beispiel Kunden mit 600.000 Euro Volumen, die absolut nicht ins Private-Banking-Segment gehören – aber dort aufgrund starrer Vorgaben automatisch einsortiert wurden. Ich kenne Regionalinstitute, bei denen dieser Vorgang mal eben so über 3.000 (!) Kunden ins Private Banking spülte.
Das ist auch aus Sicht der Kunden nicht schön: Sie erhalten bei ihrer Umsegmentierung eine unpersönliche Benachrichtigungs-E-Mail (was absolut GEGEN den Charakter des Private Banking steht), nur um dann gegebenenfalls Wochen oder Monate später (nach der händischen Nachprüfung) doch wieder ihrem angestammten Berater zugewiesen zu werden.
Nutzen Sie Dummy-Beraternummern zur Steuerung der Umsegmentierung
Auch ich halte Datenanalyse, Kundenidentifikation und strukturierte Segmentierung für wichtig. Gerade deshalb ist es nicht die Idee der Segmentierung, bei der ich Verbesserungspotenzial sehe, sondern lediglich die (automatisierte) Herangehensweise daran. Darum habe ich einen pragmatischen Tipp, wie Sie in Ihrem Institut die Segmentierung umsetzen und gleichzeitig das Risiko minimieren können, Kunden ohne persönliche Prüfung in Segmente einzufügen, in die sie gar nicht gehören – oder in denen sich ihre Potenziale eher schlechter identifizieren und nutzen lassen als in einem anderen Segment.
Ich empfehle: Führen Sie Dummy-Beraternummern ein. Zum Beispiel die Nummer 99: Alle maschinell erkannten Potenzialkunden werden zunächst automatisch dieser Nummer zugewiesen, um von dort aus einem passenden Berater zugewiesen zu werden. Der kann den Kunden dann gezielt ansprechen – und führt das Gespräch wirklich zu einem Kontakt und Abschluss, bleibt der Kunde im Bestand. Falls nicht, wird er an eine zweite Dummy-Nummer weitergeleitet. Diese steht dann für geprüfte, aber nicht als relevant eingestufte Kunden.
Dieses Vorgehen hat gleich mehrere Vorteile:
- Der technische Umschlüsselungsprozess ist erfüllt, ohne die Beraterkapazitäten zu überlasten.
- Es entsteht kein Wildwuchs an unpassenden Zuordnungen im echten Private Banking.
- Die Potenziale können im Nachgang manuell überprüft werden.
Die Umsetzung der Nachprüfung ist in der Praxis ebenfalls einfach: Sie lassen zunächst automatisiert Kunden segmentieren und der Dummy-Nummer zuweisen. Danach überprüft jeder Berater im Haus zum Beispiel 5 Kunden pro Tag (abhängig von der aktuellen Auslastung). Das ergibt pro Stammberater 25 überprüfte Kunden in der Woche beziehungsweise 100 im Monat oder 600 im Halbjahr. Setzen Sie 5 Berater in diesem Rhythmus an, dann sind wir schon bei 3.000 überprüften Kunden pro Halbjahr.
Alternativ können sich die Berater jeden Monat abwechseln, um sich gezielt um diese Arbeit zu kümmern. Wichtig ist lediglich, dass die Überleitung von Kunden mit hohem Potenzial dann wieder persönlich geschieht, durch den bisherigen Betreuer oder den Filialleiter – denn das Mensch zu Mensch (MzM) bleibt weiterhin extrem wichtig für die Kundenbeziehung.
Segmentierung mit Dummy-Nummern – das Beste aus beiden Welten
Erfahrungsgemäß können Sie im Institut bis zu vier Dummy-Beraternummern etablieren, ohne dabei den Überblick zu verlieren oder über technische und datenschutzrechtliche Hürden zu stolpern.
- Dummy Überleitung Privatkunden
- Dummy bearbeitete Privatkunden, ohne Bedarf/Potenzial
- Dummy Überleitung Unternehmer
- Dummy bearbeitete Unternehmer, ohne Bedarf/Potenzial
Diese Dummy-Nummern helfen, bei der Segmentierung Ihrer Kunden Probleme zu vermeiden, die durch ein allzu mechanistisches Vorgehen entstehen könnten. Zwar wenden gefühlt 8 von 10 Instituten diese Methode noch nicht an, doch das hat erfahrungsgemäß oft eher mit einzelnen Bedenkenträgern zu tun, die das automatisierte System nicht durcheinanderbringen möchten (was man mit dieser Methode eben nicht macht) und dafür oft vorgeschobene Gründe (Datenschutz etc.) anbringen. Bei der überwiegenden Menge aller Führungskräfte und Mitarbeiter trifft das System jedoch zumindest nach meiner Erfahrung auf große Zustimmung.
Beachten Sie außerdem, dass die Prüfung der Kunden, denen eine Dummy-Nummer zugewiesen wurde, durch fachlich qualifizierte Berater stattfinden muss – das ist keine Beschäftigungsmaßnahme für Azubis oder Praktikanten! Generell sollte der Aufwand realistisch geplant und intern verteilt werden. Erstellen Sie zum Beispiel eine standardisierte Checkliste mit 4 bis 5 Erst-Prüfkriterien und führen Sie dann einen ersten Quick-Check pro Kunde durch – der braucht nicht länger als 10 Minuten zu sein, sodass Sie in nur einer Stunde schon 6 Kunden durchgearbeitet haben. Beachten Sie jedoch: Selbst wenn Sie den Quick-Check nur auf 5 Minuten ansetzen, benötigen Sie so schon bei 200 zu prüfenden Kunden über 16 Stunden – planen Sie den zeitlichen Aufwand im Team also im Vorfeld gut ein.
Haben Sie die zeitliche Planung allerdings gut umgesetzt und die entsprechenden Dummy-Nummern erzeugt, dann ist diese Methode eine technisch saubere Möglichkeit, die Vorteile automatisierter Segmentierung mit einer manuellen Prüfung durch qualifiziertes Personal zu kombinieren. Das erlaubt Ihnen wieder eine gezielte und qualitativ hochwertige Kundenansprache. Und durch den größeren vertrieblichen Fokus können Sie deutlich effizienter das tun, wofür die Segmentierung eigentlich gedacht ist: schlummernde Potenziale eröffnen und für zusätzliche Erträge nutzbar machen!
Kontakt

Dirk Wiebusch
info@ifuf.de