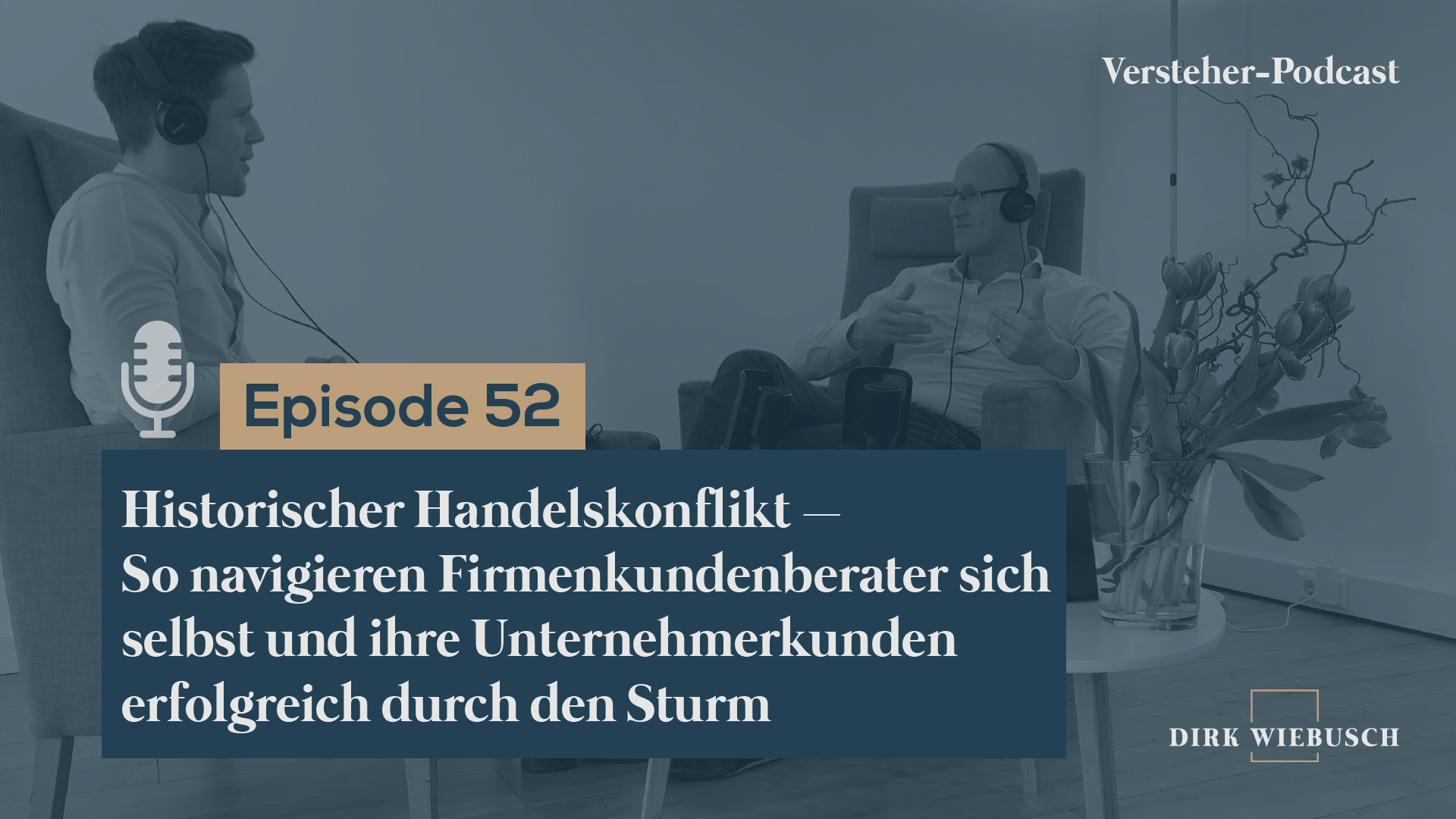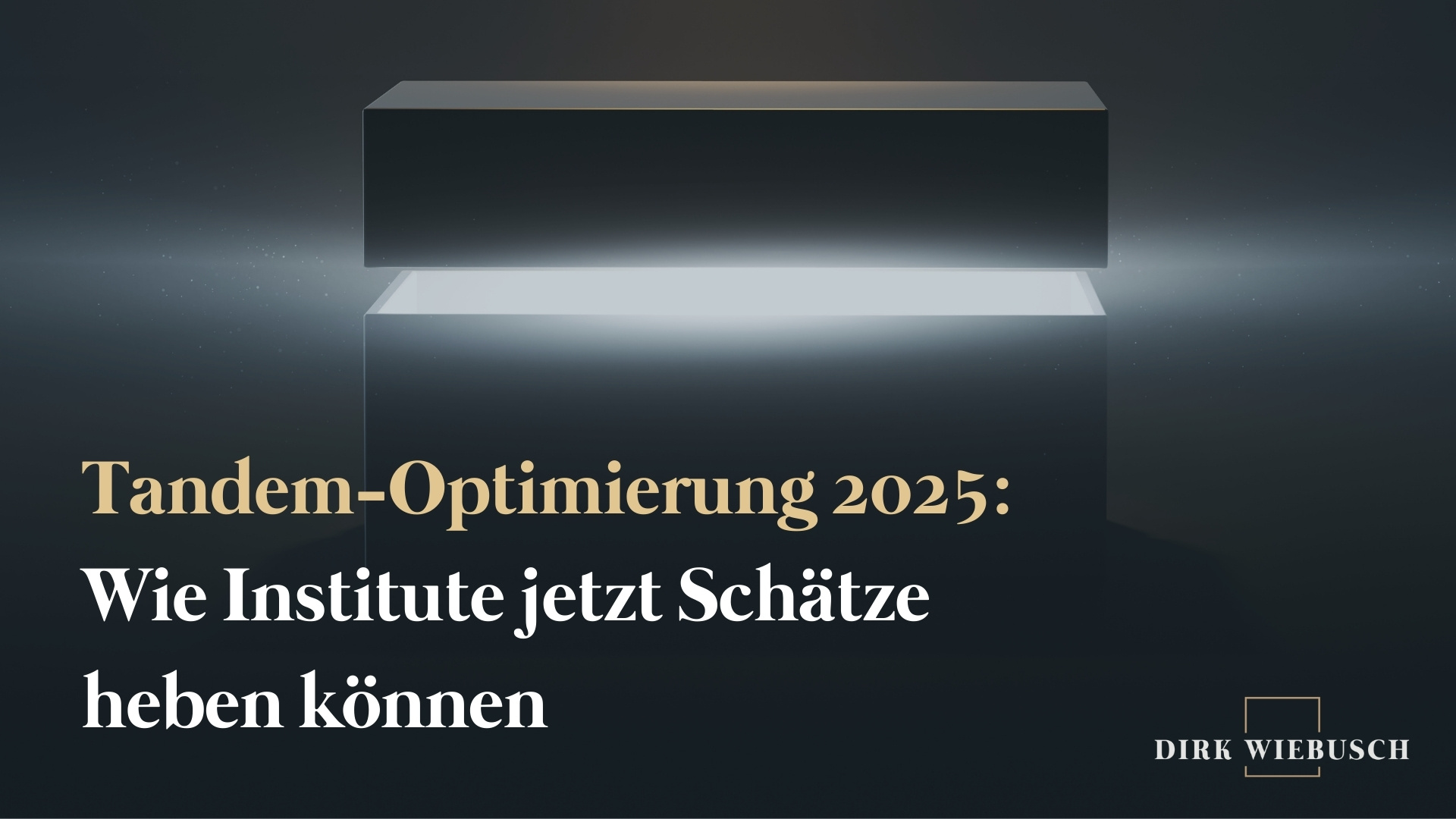Vor einer Woche waren wir mit dabei, als David Wagner sich daran zurückerinnerte, wie er sich damals, vor 40 Jahren, den Traum von der eigenen Firma erfüllte (hier geht es zu Teil 1). Und wir waren mit dabei, als er sich an den Moment erinnerte, in dem er mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontiert worden war: Dass in seinem Unternehmen nicht alles so glatt lief, wie er sich das erhofft hatte. Vielleicht wäre damals sogar der ganze Traum kaputtgegangen, wenn da nicht dieses Telefonat gewesen wäre.
Eine schwierige Entscheidung
David nimmt einen weiteren Schluck aus seinem Glas, atmet das markante Aroma des dunklen Weins ein und lässt seinen Blick über den Garten schweifen. Er erinnert sich noch gut an den aufgewühlten Zustand, in dem er damals nach Hause gekommen war. Und an seine Wut auf die Banker, die ihn wohl für unfähig hielten, seine eigene Firma zu leiten. Wie instinktiv griff er damals zum Hörer und rief Rudolf Seiler an – er hatte David damals den entscheidenden Anstoß zur Gründung der eigenen Firma gegeben und sicher würde er auch jetzt einen Ausweg wissen.
Rudolfs Rat war überraschend: „Zwei Dinge sollten Sie sich merken. Erstens: Gute und erfolgreiche Unternehmer arbeiten AN der Firma und nicht IN der Firma. Zweitens: Kreditgeber sind die letzten, die ein Interesse am Untergang einer Firma haben. Sie wollen Geld verdienen. Und mit insolventen Firmen verdienen sie nun mal nichts.“
David hatte eigentlich gehofft, dass Rudolf ihm recht geben, ihn in Schutz nehmen würde. Doch sein alter Vertriebs- und Führungstrainer hatte ins Schwarze getroffen: Hatten die Banker nicht genau das gesagt? An insolventen Firmen sind sie nicht interessiert. Er ging in sich: Hatte er den Satz in der Hitze des Gefechts falsch verstanden? Wenn Rudolf das sagte, klang es so einleuchtend. Nicht mehr wie eine Drohung, sondern wie ein einfacher Fakt.
Vier geschlagene Wochen brütete David über diesem Gedanken. Vier Wochen, in denen sich sein Arbeitspensum überschlug, in denen er stundenlang mit seiner Frau und seinem Mentor Rudolf diskutierte. Vier Wochen, in denen er immer wieder die Statistik abwägte, die er in einem Vortrag zum Thema „Unternehmensnachfolge“ gelernt hatte: 20 von 100 Gründern überstehen die ersten 5 Jahre, 4 von 100 die ersten 10. Und zuletzt: Nur 1 von 500 überschreitet die 20-Jahres-Marke.
David würde nicht auf der falschen Seite der Statistik stehen! Mehr AM Unternehmen arbeiten als IM Unternehmen. Immer und immer wieder überdachte er die Idee, verwandelte sie schrittweise in einen Plan und lud schließlich sein gesamtes Kernteam zu einer Strategiebesprechung. Wie sie so alle im Kreis in seinem Büro saßen, war ihm plötzlich klar geworden, dass er sich nicht erinnern konnte, wann sie das zum letzten Mal getan hatten. Wann sie zum letzten Mal Klartext gesprochen hatten. Das waren schließlich seine Leute, denen er vertraute, die teilweise seit Tag 1 dabei waren und die wiederum auf ihn bauten. David nahm den Mut zusammen, sprach das Problem offen an und legte seinen Lösungsvorschlag dar.
Alle standen auch weiterhin hinter ihm. Sie waren sich einig: Ohne David geht es nicht. Aber es war Zeit für Erneuerung. So muss sich das für seinen früheren Arbeitgeber angefühlt haben, dachte sich David damals. Nur, dass er und sein Team sich nicht gegen die Veränderung stellen würden! Eine neue Organisationsstruktur musste her: David gab Verantwortung und Kompetenzen ab, würde mehr AN der Firma arbeiten, natürlich mit einem Vetorecht in allen Fragen. Seine Vertrauten würden das Geschäft IN der Firma lenken. Mit dem neuen Plan ging David zu seinen Banken und stieß auch dort auf breite Zustimmung. Spätestens jetzt war ihm klar, dass er sie tatsächlich missverstanden hatte: Die Banken hatten kein Interesse an insolventen Kunden – und deshalb wollten sie ihm helfen, genau dieses Schicksal zu vermeiden.
Über den eigenen Schatten gesprungen
Der anfänglichen Euphorie folgte jedoch erst einmal Ernüchterung: Ganze 3 Jahre sollte es noch dauern, bis der neue Weg merkliche Verbesserungen für das Betriebsklima und die Bilanz des Unternehmens brachte. 3 Jahre, in denen sich an Davids persönlicher Situation kaum etwas änderte: Er arbeitete immer noch viele Nächte durch, hatte kaum Zeit für seine Familie. Er fühlte sich mit einem Mal in die Zeit der Firmengründung zurückversetzt: Stammkunden kauften plötzlich nichts mehr, Zusagen wurden zurückgenommen. An anderen Tagen kamen überraschend lukrative Aufträge rein, die sein Team in Rekordzeit abwickeln konnte. Zuversicht und Zweifel wechselten sich fast täglich ab.
Dann, irgendwann, ging es auf einmal langsam wieder mehr bergauf. Die Kunden waren jetzt teilweise andere und die neuen Mitarbeiter in der Firma waren motivierter und identifizierten sich voll und ganz mit dem Unternehmen – bei ihrer Auswahl wurde jetzt von Davids Vertrauten genauer hingeschaut. Als Chef überließ David die minutiöse Organisation der Firma nun verstärkt seinen Mitarbeitern, arbeitete selbst mehr AN der Firma – das heißt, er kümmerte sich verstärkt um die Strategie und die Zukunft, und stand seinen Mitarbeitern mit Rat zur Seite. Schon bald lief alles wie geschmiert und David konnte endlich wieder uneingeschränkt stolz auf seine Firma, seine Mitarbeiter und sich selbst sein. Das lag auch daran, dass er nun öfter als früher Zeit zuhause verbringen konnte: Die Kinder waren zwar schon erwachsen und studierten, doch mit seiner Frau Marlies konnte er nun endlich ausgedehnte Urlaube machen und gemeinsame Hobbys verfolgen. Und das alles, obwohl er eigentlich immer noch 12-Stunden-Tage in der Firma hatte.
Ein neuer Anfang
Das Unternehmen schaffte den Sprung über die 20-Jahres-Marke! Das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Mitarbeiter aller Positionen, treue Kunden wie Willi Meier, Geschäftspartner und Bankberater versammelten sich zu einem Fest, das alles in den Schatten stellte, was man im Betrieb je erlebt hatte.
Auch Rudolf Seiler war selbstverständlich mit dabei – er hatte schließlich auf seine eigene Weise zum Erfolg der Firma beigetragen. Und er nahm David auch diesmal, kurz nach Mitternacht, wieder beiseite und stellte ihm eine Frage: „Und jetzt? Wie soll es weitergehen?“ David war zunächst verwirrt: „Na, so wie jetzt, oder nicht?“ Doch so leicht ließ sich Rudolf nicht abwimmeln: „Anders gefragt: Was wollen Sie am Ende übergeben? Und an wen?“ Zunächst war David nur verwundert über die plötzliche Frage: Nachfolgeregelung mit 50? Wozu jetzt schon? Und dann fiel ihm wieder dieser Satz ein: „Erfolgreiche Unternehmer arbeiten AM Unternehmen, nicht IM Unternehmen.“
David verstand, dass er nicht bis zum letzten Augenblick warten konnte. Also fragte er sich zunächst, was er denn eigentlich übergeben wollte. Das war einfach: Er wollte nicht nur die Firma, die Vermögenswerte und den Kundenstamm vererben, sondern mehr: eine Unternehmenskultur, das Miteinander zwischen Unternehmensführung, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden. Er wollte, dass seine Firma auch nach seinem Ausscheiden noch denjenigen Werten verpflichtet war, die er und seine Teammitglieder sich damals als Vorbild genommen hatten, als sie an dem kleinen Grillabend handschriftlich die groben Ideen des gemeinsamen Unternehmens niederlegten.
Danach widmete er sich der Frage, wer denn all das bekommen sollte. Seine Kinder entschieden sich schnell dagegen. Das war David eigentlich schon vorher klar gewesen. Doch der Gedanke, die Firma an einen Fremden abzugeben, gefiel ihm nicht. 20 Jahre Schweiß und Tränen für die Familie – und jetzt wollten beide Kinder den Betrieb nicht übernehmen. In die Enttäuschung mischte sich jedoch auch ein gewisser Stolz. Klar und fokussiert den eigenen Weg zu gehen – war es nicht letztlich das, was ihn auch immer angetrieben hatte? War es nicht das, was das Unternehmen überhaupt erst ins Leben gerufen hatte?
David wurde klar, dass er für eine vertretbare Nachfolgeregelung also nicht nur eine Firma schaffen musste, die er ruhigen Gewissens übergeben könnte. Er musste auch jemanden finden, dem er das Unternehmen anvertrauen konnte.
Spreu und Weizen
David musste sich die kommenden Jahre genau im Unternehmen umschauen: Seine alten Weggefährten würden ja zu ganz ähnlichen Zeitpunkten in Rente gehen, wie er – die kamen für die Übergabe also nicht in Frage. Für wen endete der Weg vielleicht schon heute? Wer waren die Leute, die in einigen Jahren bereit waren, die Firma zu übernehmen? Und wen von den Jüngeren würden diese Leute wiederum brauchen, um auch nach der Übernahme noch auf Top-Mitarbeiter und Vertraute zurückgreifen zu können? Ähnlich dachte David über die Kunden, Geschäftspartner und Banken nach, die ihn auf seinem Weg begleitet hatten: Wer würde vielleicht in Zukunft nicht mehr zum Unternehmen passen, wer würde den nachfolgenden Leuten das Leben schwer machen und wer würde sich auch nach der Übernahme noch als treuer Wegbegleiter erweisen?
Das alles war überhaupt nicht leicht. Nicht nur, weil es schwer war, fundierte Entscheidungen über die Zukunft zu treffen, sondern auch, weil David Loyalität immer wichtig gewesen war. Insbesondere die Loyalität zu seinen Mitarbeitern. Nun musste David wegweisende, aber oft auch harte Entscheidungen treffen, die in vielen Fällen darin mündeten, dass ungeeignete Mitarbeiter freigesetzt oder Mitarbeiter mit einem festen Platz in der Zukunft des Unternehmens bevorzugt wurden. Dabei ging es nicht immer sachlich zu, denn selbstverständlich gab es auch Widerstand. Doch David wusste, dass die Zukunft des Unternehmens wichtiger war als alle Bedenken.
Der Aufschwung
In den kommenden Jahren half es David zu sehen, dass sich die Firma und sein Privatleben immer weiter zum Besseren entwickelten: Nach den ersten Schmerzen der Neustrukturierung sahen die Zahlen mittlerweile blendend aus und auch das Betriebsklima war exzellent: Die Mitarbeiter waren hochmotiviert und eingespielt, wie ein gut geöltes Uhrwerk.
Davids Kinder waren nun endgültig flügge geworden und überließen ihm und seiner Frau Marlies ein Leben, wie sie es noch von der Zeit vor der Familiengründung kannten. Liebevoll einander zugewandt, aber mit einer viel tieferen Verbindung als früher. Endlich war Zeit und Geld da, um all das zu unternehmen, was sie sich immer ausgemalt hatten: Sie lachten, sie tanzten – zuhause und im Verein. Und sie hatten endlich die Freiheit, in langen Reisen einige der spannendsten Gegenden der Welt auszukundschaften. Sie waren endlich zusammen, zuhause, zufrieden.
Rochade
David wiegt sich im Sommerwind auf seinem Gartenstuhl: Gerade mal 4 Jahre ist es jetzt her, dass er beschloss, das Unternehmen zu verkaufen. Das war hart. Denn damals konnte er sich nicht sicher sein, was damit geschehen würde: Was würden die neuen Eigentümer mit SEINEM Unternehmen machen? Was würde aus SEINEN Mitarbeitern, die ihm all die Jahre die Treue gehalten hatten und die er nun – so kam es ihm damals vor – verkaufen und verraten wollte. Das war schwieriger als das Improvisieren zur Gründungszeit, die Herausforderungen und die Probleme nach den ersten 15 Jahren zusammen.
Die schlaflosen Nächte kamen wieder und David brütete beim Licht seiner Tischlampe über mögliche Interessenten und Angebote. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf: Wenn deine treuen Weggefährten in der Firma in einigen Jahren über dich sprechen – was werden sie über dich und die Art und Weise, wie du ausgestiegen bist, sagen? David stellte Informationen zusammen, las sich in hochkomplizierte Verträge ein und bestritt erste Verhandlungen mit potenziellen Käufern. Und von alledem durfte niemand etwas mitbekommen.
Die Kaufangebote waren zu diesem Zeitpunkt ernüchternd, denn so mancher versuchte, den Kaufpreis mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten zu drücken. David war mittlerweile geschäftlich versiert genug, um zu erkennen, dass er jemandem, der so verhandelte, unmöglich sein Unternehmen anvertrauen konnte. Zwei Jahre ließ er sich Zeit, um alles zu sondieren. Doch er war jetzt 68. Und bei manchen Angeboten wäre er fast schwach geworden, wenn seine Familie nicht schon wohlhabend gewesen wäre.
Wenn sich David heute an diese Zeit zurückerinnert, fühlt sich das fast an wie damals in der Anfangszeit: Unzählige Überstunden, in denen er hochkomplexe wirtschaftliche und rechtliche Sachverhalte abwägen musste, immer mit der Verantwortung gegenüber den eigenen Leuten und deren Familien in der einen Waagschale sowie dem Willen zur Profitmaximierung in der anderen.
Ein wirklich gutes Angebot kam erst spät in der Entscheidungsfindung: Ein befreundeter Unternehmer hatte plötzlich Interesse daran, Davids Firma zu kaufen. Das überraschte David, denn das Unternehmen seines Bekannten hatte eine völlig andere Ausrichtung und stellte Produkte her, die mit seinen eigenen nichts zu tun hatten.
Am Telefon wurde das Rätsel gelöst: „Herr Wagner“, fing der befreundete Unternehmer an, „ich stehe an einer ähnlichen Stelle wie Sie, aber bei mir wollen beide Söhne die Firma weiterführen. Und ich denke, dass die Jungs dann meine ambitionierten Führungskräfte ausblocken werden. Vor allem meine kaufmännische Leiterin hat riesiges Potenzial, das dann einfach verschenkt wäre. Meine Idee ist nun, ihre Firma zu kaufen – Sie bleiben als Elder-Statesman an Bord, ihre Führungsmannschaft macht weiter wie bisher, meine kaufmännische Leiterin wird Sprecherin der Geschäftsführung und übernimmt den Verwaltungsbereich bei Ihnen.“
David wurde es warm und kalt zugleich: Alles bleibt erhalten, seine Leute machen weiter – und er kann sich sogar weiterhin mit der Firma befassen. Das klang alles zu gut, um wahr zu sein. Spätestens beim Handschlag einige Tage später wurde sich David bewusst, was für einen Glückstreffer er gelandet hatte. Ab dann war das Unternehmen in trockenen Tüchern und David musste sich nicht mehr um die Zukunft sorgen – er hatte genug geleistet.
Ein Leben für die Firma
Heute sitzt David auf seinem Gartenstuhl, nippt an seinem Wein und genießt den geruhsamen Sonntag, auf den er ein ganzes Leben lang hingearbeitet hat. Wie so viele Familienunternehmer hat er Jahre der Entbehrung, der Begeisterung, der Aufopferung und des Erfolgs mitgemacht. Wie so viele hat er harte Entscheidungen treffen und dabei so manchem Freund und Weggefährten vor den Kopf stoßen müssen. Doch der Blick zurück sagt David: Das war es wert gewesen.
Ich hoffe, Sie konnten anhand von Davids Biografie einen Einblick erhalten, welche Wünsche und Nöte, Stärken und Schwächen ein Familienunternehmer mit sich bringen kann. Und welche Erlebnisse es sind, die seinen Charakter geformt haben. Denn das Leben im Dienste der Firma bringt diesen besonderen Menschenschlag hervor, mit dem Sie und Ihre Mitarbeiter täglich zu tun haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer eigenen Reise mit Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Werden Sie zum Unternehmer-Versteher und ein Teil dieser faszinierenden Welt.
Kontakt

Dirk Wiebusch
info@ifuf.de